Buchstaben-Esoterik und/oder Wokewriting
Damit wir uns richtig verstehen: ich beanspruche die Urheberschaft an dem Begriff „Buchstaben-Esoterik“, der mir spontan einfielen, als ich hörte, dass es Menschen gibt, die jedem handgeschriebenen Buchstabenben eines bestimmten Schreibschrift-Alphabets „übersinnliche Kräfte“ zusprechen. Vor dem Hintergrund, dass der Duktus der Handschrift jedem Menschen ebenso angeboren ist, wie der Duktus der Stimme, halte ich es für blanken Unsinn, durch Heranziehung okkultistischer, anthroposophischer, metaphysischer oder anderer Lehren und Praktiken, Rückschlüsse auf die Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung des Menschen zu ziehen. Auch den Begriff „Wokewriting“ passt gut in dieses Metier,
Leseprobe aus „Klasse“- über die agnotologischen Strategien der Grundschulpolitik und ihre desaströsen Folgen
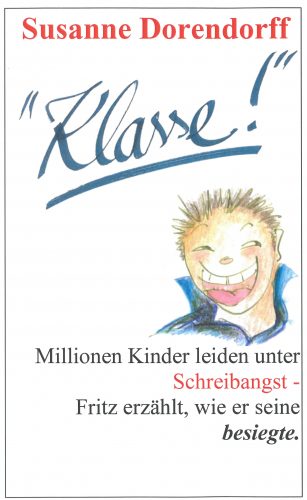 (Seite 164) »Ich erzähl euch jetzt, wie das Profitgier-Virus eines Tages nach der deutschen Schul-Idylle griff, sich klammheimlich überall andockte und wie die drastische Denk-Drosselung in Deutschland begann.« Gerd ist in seinem Element.»Irgendwer hatte das Virus eingeschleppt. Wirklich irgendwer? Oder wurde es als Schulbildungsvermarktungsidee aus den USA zu uns herübergeschwappt? Egal. Das Grundbildungsvernichtungsvirus mutierte schnell und zwang unsere arglose Schulwelt (viele Lehrerinnen, Lehrer und Eltern waren damals noch genauso gutgläubig wie heute) ganz langsam in die Knie und dann ungebremst in die Lerninsolvenz. Der Plan ging auf. Welcher Plan? Dummheit zu Geld machen. Und wie leicht das war! Alle machten mit. Alle riefen: ›Ich auch, ich auch!‹ Kein Mensch protestierte. Im Gegenteil. Der Trick war: Begehr muss her! Weil aber anfangs kein Begehr da war – der deutsche Dichter- und Denker-Bildungsstandard galt als zufriedenstellend –, wurde er geschaffen. Das ging verblüffend schnell und war strategisch total simpel: möglichst viel Chaos und nachhaltigen Schaden anrichten. Wir kennen das auch aus anderen Branchen: erst ein- oder abreißen, dann teuer erneuern. Bildungsvermarktung funktioniert nach demselben Prinzip. Und Profitgier kann eben auch Grundschule. Nachhilfe-Franchise-Unternehmen hatten wir vor 1969 nicht und brauchten sie auch nicht. Danach ja.« »Ich verstehe«, meint Anne. »Und so sollte es dann bleiben. Der Markt sollte dauerhaft beherrscht werden. Denn je größer der Schaden, desto größer der Gewinn. Also musste das Begehren langfristig gesteuert und großzügig und eigennützig befeuert werden. Wenn möglich seriös. Wenn nicht, dann nicht. Wie fies ist das denn?« »Tja, aber lässt sich die Schulbildung überhaupt dauerhaft schädigen? Na klar: indem man den Unterricht für Lesen, Schreiben, Rechtschreiben und Rechnen abschafft. Bevor jetzt irgendjemand dazwischenruft: Das geht nicht! Erinnere ich kurz an den GSV und dessen Aktivitäten. Seht ihr: der Kreis schließt sich langsam.«
(Seite 164) »Ich erzähl euch jetzt, wie das Profitgier-Virus eines Tages nach der deutschen Schul-Idylle griff, sich klammheimlich überall andockte und wie die drastische Denk-Drosselung in Deutschland begann.« Gerd ist in seinem Element.»Irgendwer hatte das Virus eingeschleppt. Wirklich irgendwer? Oder wurde es als Schulbildungsvermarktungsidee aus den USA zu uns herübergeschwappt? Egal. Das Grundbildungsvernichtungsvirus mutierte schnell und zwang unsere arglose Schulwelt (viele Lehrerinnen, Lehrer und Eltern waren damals noch genauso gutgläubig wie heute) ganz langsam in die Knie und dann ungebremst in die Lerninsolvenz. Der Plan ging auf. Welcher Plan? Dummheit zu Geld machen. Und wie leicht das war! Alle machten mit. Alle riefen: ›Ich auch, ich auch!‹ Kein Mensch protestierte. Im Gegenteil. Der Trick war: Begehr muss her! Weil aber anfangs kein Begehr da war – der deutsche Dichter- und Denker-Bildungsstandard galt als zufriedenstellend –, wurde er geschaffen. Das ging verblüffend schnell und war strategisch total simpel: möglichst viel Chaos und nachhaltigen Schaden anrichten. Wir kennen das auch aus anderen Branchen: erst ein- oder abreißen, dann teuer erneuern. Bildungsvermarktung funktioniert nach demselben Prinzip. Und Profitgier kann eben auch Grundschule. Nachhilfe-Franchise-Unternehmen hatten wir vor 1969 nicht und brauchten sie auch nicht. Danach ja.« »Ich verstehe«, meint Anne. »Und so sollte es dann bleiben. Der Markt sollte dauerhaft beherrscht werden. Denn je größer der Schaden, desto größer der Gewinn. Also musste das Begehren langfristig gesteuert und großzügig und eigennützig befeuert werden. Wenn möglich seriös. Wenn nicht, dann nicht. Wie fies ist das denn?« »Tja, aber lässt sich die Schulbildung überhaupt dauerhaft schädigen? Na klar: indem man den Unterricht für Lesen, Schreiben, Rechtschreiben und Rechnen abschafft. Bevor jetzt irgendjemand dazwischenruft: Das geht nicht! Erinnere ich kurz an den GSV und dessen Aktivitäten. Seht ihr: der Kreis schließt sich langsam.«
Unterschrift verbessern – die Video-Galerie
2 Basis-Videos und ein paar Buchstaben-Videos – extra in nicht alphabetischer Reihenfolge.
Finde deinen Anfangsbuchstaben!
1 – Die Basis: Fünf Schreib-Eigenschaften machen dich glücklich
2 – Du wirst sie lieben. Deine Unterschrift. Zum Coaching-Start (1) zeige ich dir 6 Basis-Tipps!
P – Extra für Jungs! Schreib niemals dieses P! Unterschrift-Vorschlag P (Lection 5 von 31)
Y – Yäss you kenn! Unterschrift-Vorschlag Y (Lection 27 von 31)
Videos zum Unterschrift-Coaching „Extra für Männerhände“
Zum Video hier klicken > Mein Hand- und Unterschrift-Coaching für Männerhände
Die Basis meines Coaching-Konzepts: Schreiben ist der einzige spontan-materialisierbare Ausdruck den wir haben, und: Lachen öffnet das Verstehen. Sie haben sich lange genug gequält. Wir sitzen uns in lockerer Atmosphäre am Tisch gegenüber. Ihre bisherige Unterschrift ist, weil es um Ihre neue, freifließende Schreibtechnik geht, kein Thema. Sofort vergessen Sie Ihre Schreibblockaden. Ein viriles Graphit-Schreibtool liegt locker in Ihrer Schreibhand. Sie schreiben, ich mache Vorschläge, Sie lassen sich inspirieren. So erschreiben Sie sich sehr schnell Wesentliches über den authentischen Ausdruck Ihrer Unterschrift.
Denken ist DIE pädagogische Grundlage der Schulen – und Schreiben ist die Königsklasse der Pädagogik.
Ohne Gedanken ist Bildung nicht möglich. Gedanken müssen fixiert werden, um nachhaltig bestehen zu können. Man schreibt sie auf. Schreiben ist also die Basis aller Bildung.
Das heißt: Aufschreiben ist Denkschreiben oder Schreibdenken – also Denken und Schreiben in Einem (2 in 1), zwei in einem Federstrich. Gedankenfluss und Schreibfluss sollten also
möglichst synchron verlaufen. Das können sie nicht, denn Denken ist schneller als Schreiben, weil wir in fertigen Wörtern formulieren und nicht – wie bei der Druckschrift und dem Tastschreiben, die Wörter aus Einzelbuchstaben zusammensetzen müssen. „Tipper“ und „Drucker“ sind die „Wegschnecken des Schreibprozesses“. Sie bleiben auf der Strecke, sobald es um Leistungsoptimierung geht.
Beide, die Fließgeschwindigkeit der Gedanken und die Geschwindigkeit der Handbewegung müssen zu einem dualen System verschmelzen. Das heißt, sie werden cerebral-motorisch oder besser: „hirn-händisch“ selbsttätig miteinander verknüpft. Aus dieser Verbindung entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Hand-schreib-Technik, die das Fixieren der Gedanken entschieden erleichterte: die Technik des manuellen Verbindens spezieller Schriftzeichen. Mit großem Erfolg: das Alphabet der lateinischen Schreibschrift begann ihren Siegeszug vor mehr als 500 Jahren und wurde die Schrift der Gelehrten genannt. Gedanken konnten von nun an flott per Hand und mit einem Stift in persönlicher Handschrift aufgeschrieben werden.
Das Alphabet der lateinischen Schreibschrift ist das Ausgangsmaterial für die Technik des Handschreibens, also dem Fixieren fließender Gedanken in eigener Schrift. Und weil diese Art des schreiben Lernens, ein spezielles, ergonomisch und physiologisch durchdachtes und obendrein leicht zu erlernendes Alphabet erfordert, ist das Design der lateinische Schulschreibschrift so, wie es seit 1953 zur Verfügung steht: schnörkellos und leicht variierbar.
Die lateinische Schulschreibschrift ist als einziges Alphabet „dynamisch“, weil es im Gegensatz zu allen anderen Schriften, so konzipiert ist, dass es zum Verändern durch kleine Kinderhände geeignet ist. Alle anderen Alphabete sind „statisch“. Das heißt, sie taugen nicht für händisches Schreiben, geschweige denn zum Variieren. Die lateinische Schreibschrift ist also die Handschrift-Vorlage für jedermann – sprich: für jedes Kind. Sie ist eine „Ausgangsschrift“. Die Handschriften, die die Kinder davon ableiten, können der Vorlage nicht 1:1 entsprechen und sollen es auch nicht. Demzufolgekommt der Optik der persönlichen Kinderschrift eine besondere Rolle zu. Der Handschriftduktus, die „typische Handschrift“ der Kinder entsteht quasi selbsttätig aus der Harmonie heraus, sobald die Hirn-Hand-Bewegung und die Lesbarkeit übereinstimmen. Schreiben geht dann leicht von der Hand. Das ist das Ziel. Die lateinische Schreibschrift ist ein Medium, das den Menschen ermöglicht, die mental-manuelle Reflektions-Technik „Handschrift“ zu beherrschen und überall ausüben zu können.
Das bedeutet: praktizierter Handschrift-Erwerb ist DAS Zeichen pädagogischer Verantwortung.
Die Buchstaben der Schulalphabete Druck- bzw. Grundschrift und die der sogenannten Vereinfachten Ausgangsschrift, werden nicht in „einem Zug“ geschrieben und auch nicht verbunden, sondern aus senkrechten, diagonalen und runden Teilsegmenten gebildet und aus unverbundenen Einzelzeichen nach dem „Baukastensystem“ aneinandergereiht. Dies permanente Anheben und Absetzen des Stiftes führt zu Bewegungsunterbrechungen, die den Fließanspruch des Schreibens konterkarieren. Zu fließendem „Denkschreiben“ (im Sinne intellektueller Leistungsoptimierung) sind sie nicht geeignet.
So, wie die lateinische Schreibschrift immer ein Zeichen für Bildung und Fortschritt ist, so ist die Druck-bzw. „Grundschrift“ (gemäß der Freinet-Didaktik) das Zubehör einer kommunistisch-sozialistischen Ideologie für „Kinder der Unterdrückten“ aus den 1920er Jahren, mit dem Credo „Kindern das Wort geben – egal wie sie schreiben, ohne Regeln und ohne Vorschriften “.
Das daraus resultierende ersatzlose Streichen des Schreibunterrichts in der Grundschule vor über vier Jahrzehnten und der damit verbundene Verdrängungsprozess der lateinischen Schreibschrift, verursachten ein desaströses Bildungsdefizit: 14% (7,5 Millionen) erwerbstätige „funktionale“ Analphabeten in Deutschland! Mit steigender Tendenz. Der volkswirtschaftliche Schaden ist nicht abzusehen.
Deshalb ist die Wiedereinführung des Schreibunterrichts ab Klasse 1 und die Rückkehr zur lateinischen Schreibschrift aus wissenschaftlicher, bildungspolitischer und pädagogischer Sicht unbedingt erwünscht. Physiologen, Neurobiologen und Psychologen bestätigen dies und unterstützen diese Forderung.
Denn Denken – darin sind wir uns ja alle einig – Denken ist DIE pädagogische Grundlage der Schule und Schreiben ist die Königsklasse der Pädagogik.
Ich bin sicher, alle Grundschullehrerinen würden sehr gern und erfolgreich Handschrifterwerb unterrichten, gäbe es einen Lehrstuhl für Handschrift- und Rechtschreib-Didaktik.
Die Handschrift stirbt mit dem letzten Menschen. Vorher ganz bestimmt nicht.
Der ausführliche Text ist in Arbeit.
Kommentare nehmen wir dennoch gern entgegen …
Bitte hören und sehen Sie zuvor das Gespräch auf YouTube
oder nur hören als
Podcast „Schreibgeflüster“ mit Claudia Sprinz
Lehren heißt Erklären! Besonders beim Schreiben lehren.
Wir folgen dem gesunden Menschenverstand und den Ausführungen des Neurobiologen Gerald Hüther
Interview zum Welttag des Briefschreibens 1.9.2022 für Fa. Hach „Schreiben mit der Hand ist Denken auf Papier“
HACH: Liebe Frau Dorendorff! Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit haben und uns in die Welt der Schrift und des Schreibens entführen wollen. Wann haben Sie Ihren letzten handgeschriebenen Brief verfasst? Welches Schreibgerät haben Sie verwendet?
Susanne Dorendorff: Es war ein 26-seitiger Brief an Doris Dörrie. Ihr Buch Leben.Schreiben.Atmen (zum Thema kreatives Schreiben) hat mich inspiriert, sie darauf aufmerksam zu machen, dass das Alphabet nicht (wie sie in Talkshows gern behauptet) lediglich aus 26 Buchstaben besteht. Ein paar mehr sind es schon: 59 (für Deutsch im Spanischen ist es etwas anders).
Ich habe mit Füller geschrieben. Meine Tinten mixe ich selbst. Die Tinten an Dörrie war Lindgrün. Die Farbe der Tinte wirkt – ebenso wie der Duktus der Handschrift – suggestiv auf die unbewusste Empfindung des Lesenden. Hat also große Bedeutung. Denken Sie an das fiese Rot der Lehrerinnen! Die steckt dem meisten Schülern bis ins Greisenalter in den Knochen.
HACH: Handgeschriebene Zeilen werden immer seltener.
Susanne Dorendorff: Das sehe ich anders. Vor dem Computer gab es die Schreibmaschine, die machte damals genauso einen Wirbel wie der Computer. Das Schreiben mit der Hand stirbt aus. Kein bisschen! Die hirnrissig und nahezu ununterbrochene Tipperei auf Handytasten, inkl. angebotenen Silben und Wörtern sind kein Maßstab für den Vergleich viel mehr (tippen) versus viel weniger (schreiben).
HACH: Mittlerweile gibt es sogar Spracherkennung Assistenzsysteme, die das gesprochene Wort in Schriftzeichen übertragen. Immer weniger Menschen schreiben deshalb mit den Tasten, geschweige denn mit der Hand. Wird die Handschrift in den nächsten Jahrzehnten zum immer selteneren Kulturgut?
Susanne Dorendorff: Eine neue Technik beunruhigt die Menschen seit Menschengedenken, wie jetzt die Digitalisierung. Doch keine Angst, sie befruchten sich gegenseitig:
Beides heißt Schreiben. Und das ist auch gut so. Denn beide gehen nebeneinander her wie zwei Beine. Wir laufen schließlich auch auf zwei Beinen ins Ziel, und humpeln nicht auf nur einem über die Linie.
Handschrift und Tippen sind wie Yin & Yang, wie Forschung und Lehre: Die eine ist die Struktur, der andere ist der Mensch. Sie brauchen sich. Gegenseitig. Sie sind einander ein gigantischer Gewinn. Jeder, der sie beherrscht, weiß das.
Die Basis beider Schreibtechniken ist das Denken. Schreiben mit der Hand ist Denken auf Papier. Schreiben auf der Tastatur ist Denken digital.
Darum ist und bleibt der Wille des schreibenden Menschen das Maß aller Gedanken. Sagen wir mal so: Du gehörst zu denen, die eine eigene Handschrift haben. In allem. Du lässt dich nicht täuschen, du lässt dir nicht reinreden. Du schreibst mit der Hand. Der Politik zum Trotz, die das Handschreiben seit fünfzig Jahren torpediert. Du schreibst weiter. Du bist autark. Du besitzt einen Schrank voller Notizbücher. Du gehörst zu den Scharfsinnigen, den Kreativen, den Zukunftsfähigen. Du bist der Mensch, der die Technik beherrscht und nutzt. Du erkennst in deiner Handschrift dich selbst, deine Gefühle, deine Leistung und deinen Erfolg.
Mit deiner Handschrift bist du dir nah. Jeden Tag.
HACH: Auch wenn es im Berufsleben immer digitaler wird, viele Karriereratgeber betonen die Wichtigkeit einer guten Handschrift. Kann die Handschrift wirklich etwas über die Persönlichkeitsstruktur, über Charisma und beruflichen Erfolg aussagen?
Susanne Dorendorff: Tatsächlich fürchten viele Menschen (jeden Bildungsstands) genau DAS: die Handschrift verrät meinen (schlechten) Charakter! Das ist Quatsch.
Handschriftliches kann Ausdruck der Persönlichkeit des Schreibenden sein. Aber der Duktus der Handschrift wird lediglich subjektiv, also angenehm oder unangenehm empfunden werden. Mehr nicht. Wissenschaftliches Erforschen ist hier wohl angebracht.
Handschrift entsteht durch spontane Bewegungen, die weder kalkulierbar, noch analysefähig sind. Es sind emotionale Reaktionen, die sich nicht voraussagen lassen, weil sie intuitiv ablaufen. Sie bilden also keine feststehende oder unveränderbare Größe. Das einzig Zuverlässige an der Charakterlichkeit des Menschen ist seine Unberechenbarkeit, seine Spontaneität, also seine unergründliche Wandelbarkeit.
Kein zuverlässiger Mensch ist immer zuverlässig, und kein Pionier ist durchgehend mutig. Gefühlsbetonte Handlungen kann man nicht als vorhanden und immerwährend bezeichnen oder sie sogar als zuverlässig eintreffende Impulse erwarten, denn sie sind so launenhaft wie die Stimmungen der Menschen selbst.
Ausdruck und Eindruck sind subjektive Empfindungen und keine Voraussetzung für belastbare Charakterstudien.
HACH: Beraten und trainieren Sie auch zum Thema Karriereplanung durch eine gute Handschrift?
Susanne Dorendorff: Eine charismatische Handschrift ist ein international anerkanntes Statussymbol.
HACH: Nach wie vor lernen deutsche Grundschüler das Schreiben erst mit dem Bleistift, dann mit dem Füllfederhalter. In anderen Ländern öffnet ein Kugelschreiber die Tür in die Welt der Handschrift. Ist das Schreibgerät wirklich so entscheidend, ob gerne und leserlich geschrieben wird?
Susanne Dorendorff: Kein Schreibgerät „öffnet kleinen Kindern die Welt der Handschrift“! Ausschlaggebend für die Freude am Schreiben ist allein, dass Stiftführung, Buchstaben und die Schreibbewegung erklärt werden … Die „Welt der Handschrift“ ist in Deutschland immer noch ein Rätsel. Kugelschreiber gehören nicht in Kinderhände. Für Anfänger ist der Bleistift gut geeignet, weil sie damit nach Herzenslust aufdrücken können, bis sie gelernt haben, dass die Buchstaben davon nicht besser werden. 😉
HACH: In Ihrer Kunst bringen Sie die Buchstaben zum Sprechen. Dabei haben Sie den Begriff visuelle Poetik geprägt. Schreiben transportiert dabei nicht nur reine Informationen, sondern auch Gefühle.
Susanne Dorendorff: Meine Schreibkunst ist dem japanischen Sho-do verwandt. Schreiben (am besten mit Pinsel) ist kunstfähig, weil die authentische Schreibbewegung die Ausdruckskraft des Menschen so stark transportieren kann, dass der Ausdruck seine eigene, künstlerische „Sprache“ entfaltet. Dann sagt man, dass das Geschriebene „spricht“. Diese Art zu Schreiben erfordert ein langes, ausdauernde Studium.
HACH: Gleichzeitig gibt es eine Revolution zum Thema Handlettering und Schönschrift.
Aber wo grenzt sich Handlettering von Schönschrift für Sie ab?
Susanne Dorendorff: Nicht nur für mich – für Alle: Schrift und Schreiben sind zweierlei.
Schrift (Typografie, Satzschrift, Kalligrafie) ist eine grafische Norm, ein Formenkanon (Ursprung ist die RÖMISCHE CAPITALIS [nur Großbuchstaben] – das lateinische Alphabet) auf den wir uns vor 2.000 Jahren (kulturell) geeinigt haben.
Schreiben mit der Hand ist ein psycho-physiologischer Vorgang, an dem mehr als alle Sinne beteiligt sind. Schreiben ist eine authentische, spontane, intuitive, höchst emotionale und flexible, vom Unterbewusstsein gesteuerte Bewegung, die variiert. Seine Buchstaben sind untereinander nicht identisch.
Handlettering und Kalligrafie (Buchstabenmalen und Schönschreiben) haben nichts, gar nichts – zumeist nicht einmal buchstäblich das geringste mit Handschrift gemein – was die 5 Haupteigenschaften der Handschrift ganz einfach belegen: Authentizität, Spontaneität, Intuition, Emotionalität und Asymmetrie (kurz: ASIEA) Handlettering und Kalligrafie verfügen über keine dieser Eigenschaften – im Gegenteil, beide Kategorien sind zwar buchstabenbasiert, werden jedoch konzipiert (vorgezeichnet) und transportieren grundsätzlich nicht die spontanen Gedanken des Zeichnenden, sondern Sprüche oder Zitate, sie dienen ausschließlich dekorativen Zwecken.
HACH: Liebe Frau Dorendorff! Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Gedanken und wirklich interessanten Einwürfe zu diesem Thema Schreiben und Schrift. Für Ihr neues Projekt TIETUS wünschen wir Ihnen von Herzen sehr viel Erfolg!
Die Big Five des Schreibens bestimmen seinen Charakter. Darum kann keine Handschrift Kalligrafie sein – und umgekehrt.
Seit ich die BIG FIVE A.S.I.E.A, = A-authentisch, S-spontan, I-intuitiv, E-emotional, A-asymmetrisch< als die fünf Exklusiv-Eigenschaften der Handschrift entschlüsselt habe, ist der Weg frei für ein neues Kunstformat. Erst die Kenntnis der spezifischen Schreib-Charakteristika erschließt die Fähigkeit, Schreiben als einen hochkomplexen emotionalen Vorgang zu erfassen und künstlerisch anzuwenden. Keine dieser Eigenschaften zeichnen die Kalligrafie (Schönschrift) aus. Das bedeutet: wo Schönschreiben ist, ist keine Handschrift – sie schließen sich also gegenseitig aus. Handschrift und Kalligrafie sind Antipoden (Gegenspieler): „Wo der eine ist kann der andere nicht sein!“.
Video: Die „Big Five“ der Handschriften bestimmen ihren Charakter
Jungs lernen anders als Mädchen. Also unterrichtet sie auch so!
Jungen denken systemisch und möchten strukturierte Verhältnisse. Vor allem in der Schule. Sie stellen Fragen, die sie beantwortet haben möchten. Bleibt man ihnen die Antworten schuldig, verlieren sie die Lust am Lernen. Alle – auch Erwachsene – lernen durch Erkenntnisse. Alphabetisieren ist da keine Ausnahme. Wer das nicht befolgt und Schüler im Unterricht sich selbst überlässt, führt die ihm anvertrauten Kinder in die Irre. Was leider allzu oft geschieht.
Warum kann ich nicht schreiben?
Antwort: Du kannst schreiben. Dir wurde die Technik des Schreibens nur nicht richtig erklärt. In der Schule musstest du dir wahrscheinlich zuerst die Leseschrift (die auch Druck- oder Buchschrift genannt wird) selbst beibringen und dann musstest du allein eine Schrift einüben, die keine Schreibschrift ist. Schreiben hast du also nie gelernt. Deine Handschrift wartet noch auf dich.
Wie funktionieren Buchstaben?
Antwort: Wir denken in Begriffen, die aus Lauten zusammengesetzt sind. Das nennen wir sprechen und Sprache. Laute sind Sprachzeichen, die Buchstabe heißen. Buchstabenlaute werden beim Sprechen zu einem Begriff, einem Wort-„Bild“ zusammengezogen, wie zum Beispiel das Wort ich. Ich wird nicht „ih-zeh-ha“ gesprochen, sondern „ij“ – und das Wort wird geschrieben, wie man es denkt: in einem Zug … nicht abgehackt i-ce-ha. Und weil du mit der Hand so schnell schreiben willst, wie du denkst, muss es zwischen den Lauten eine Brücke geben, über die der Lautklang in den anderen hineingleiten kann. Du schreibst ich so, wie du ich denkst, als drei ineinanderfließende Laute.
Warum schreiben wir überhaupt?
Antwort: Weil wir unsere eigenen Gedanken festhalten möchten und um neue Gedanken folgen zu lassen … um uns zu erinnern … um eigene Gedanken anderen Menschen zeigen zu können.
Warum muss man Buchstaben verbinden?
Antwort: Damit die Wörter so fließen, wie die Gedanken fließen und wir den Gedanken so schnell wie möglich neue folgen lassen können. Die Verbindung zwischen den Buchstaben macht das Schreiben schnell. Schreiben ist denken in einer ununterbrochenen Linie. Auch dort, wo die Zeichen auf dem Papier nicht verbunden sind, fließt der Gedanke in der Bewegung des Stiftes weiter, so dass die Linie „unsichtbar“ weitergeschrieben wird. Die Verbindung ist der Zündschlüssel für Schnellschreiber.
Warum muss man auf einer Linie entlang schreiben?
Antwort: Auf einer geraden Straße fährt es sich leichter als auf einer kurvigen Berg-und-Tal-Bahn. Ebene Strecken sind die effizientesten (schnellsten) – darum musst du bei b, o, ö, r, v, w und x (die oben verbunden werden) aufpassen. Die Orientierung bleibt aber immer bei der Grundlinie.
Warum muss ich mit Füller schreiben?
Antwort: Musst du nicht. Mit Füller schreiben ist ein deutsches Phänomen. Tintenroller – ohne Griffmulden! – sind für Jungs genauso gut.
Dass viele Jungen unter dem absenten Schreib-Rechtschreibunterricht besonders zu leiden haben, ist kein Geheimnis. Jungs sind keine Mädchen (sic!). Sie lernen anders. Sie setzen sich nicht hin und üben schönschreiben. Das sagt ihnen nichts. Sie wollen wissen, warum sie etwas tun sollen und was sie davon haben. „Eine schöne Handschrift“ ist kein jungenhaft vielversprechendes Ziel. Wird ihnen hingegen das Schreiben richtig erklärt, kann jeder Junge sich (auch später noch) eine gute Schreibtechnik aneignen.
Die sagt, dass schlechte Handschriften auch bei Jungen keine Veranlagung sind und dass es die grafomotorische Störung beziehungsweise die Schreibschwäche nicht gäbe, brächte man den Kindern schreiben gleich richtig bei. Kinder lernen immer nur das, was ihnen angeboten wird. Die „Störungen“ und „Schwächen“ werden Kindern erst durch falsche Information antrainiert. Gehirne nehmen, was kommt, und verschalten. Nervenzellen im Gehirn können nicht wählen und schon gar nicht selbsttätig korrigierend eingreifen und verbessern, dazu fehlt ihnen die Voraussetzung. Sie stellen ausschließlich Verbindungen her und sorgen dafür, dass Informationen fließen. Das allein ist ihre Aufgabe. Stellen Sie sich vor, Neuronen und Synapsen funktionierten in etwa wie Stecker und Dosen, die zusammengefügt werden müssen, damit der Strom fließt. Ob mit dem Strom anschließend der Backofen, die Bohrmaschine oder eine Zahnbürste betrieben wird, steht nicht in der Macht von Stecker, Dose und Strom. Stellt sich später heraus, dass der Mensch sich mit der Bohrmaschine rasiert, den Kuchenteig mit der Zahnbürste rührt und die Backofenschnur dem Kühlschrank gehört, dann kann man daraus nicht einfach eine „motorische Stromstörung“ machen und hoffen, alles regelt sich von allein. Genauso ist es mit dem Schreibenlernen. Im Kopf verschalten sich Synapsen buchstäblich – in bestem Sinne des Wortes – nur nach Vorschrift. Eine verknüpfte Schreibbewegung, die sich im Ergebnis als falsch herausstellt, ist nicht die Schuld des Gehirns. Es ist der Fehler des Lehrers, der Lehrerin, der Eltern oder der Erzieher, es ist nicht die Schuld oder der Fehler des Kindes.
Das bedeutet, Schüler machen keine falschen Schreibbewegungen, sondern nur die, die sie gelernt haben (oder sich selbst beibringen mussten). Sie hatten vorher keine Störung, aber hinterher auch nicht und ganz gewiss handelt es sich um keine krankhafte Veranlagung. Erwachsene müssen bei Kindern das korrigieren, was ihnen selbst zuvor falsch beigebracht wurde. Deutlicher noch: Wer Schulanfängern Druckschrift malen als schreiben lernen verkauft und es kurz darauf wieder verbietet, um nun das richtige Schreiben zu lehren, der verursacht bei Kindern Schrei(b)krämpfe.
Für Jungen wäre schreiben lernen kein Problem, hielte man es beim Schreibunterricht wie beim Sportunterricht. Dort boxt nicht Frau gegen Mann – dort bleibt man unter sich. Weil Männlein und Weiblein naturgemäß unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, wird konsequent zwischen den Geschlechtern unterschieden: Jungen laufen schneller als Mädchen, können weiter springen und schwerere Gewichte stemmen, deshalb verläuft zwischen den Bewertungskriterien eine unsichtbare Mauer. Wieso nicht auch beim Schreiben? Wieso gilt die Durchschnittsgeschwindigkeit der Mädchen beim Erlernen des Schreibens als Standard für Jungen? Müsste dann folgerichtig nicht auch der nächste Marathonlauf nach diesen Kriterien bewertet werden – dieser und alle anderen Disziplinen, in denen Frauen aufgrund ihrer angeborenen „Leistungsschwäche“ gegen Männer chancenlos wären und permanent verlieren würden? Vielleicht wäre eine solche Vorführung mal ganz sinn- und wirkungsvoll. Denn dann würden die Frauen und Mädchen endlich nachfühlen können, wie frustriert und deprimiert viele Jungen durch die Schulzeit gehen. Jungen mit schlechter Schrift müssen in jedem Schulfach mit Punktabzug rechnen und ihre schulische Leistung wird deshalb oft nicht so bewertet, wie es ihrer intellektuellen Leistung entspricht.
Die Erkenntnis, dass Jungen physisch und psychisch anders beschaffen sind als Mädchen, ist so alt wie die Menschheit. – Wieso wird dieses Wissen beim Schreibenlernen außer Kraft gesetzt?
Dass so furchtbar viele Jungen zu Schreibverweigerern werden und Angst vorm Schreiben haben, ist also keine Frage kollektiver Minderbegabung, zurückgehender männlicher Intelligenz oder gestörter Sensomotorik. Es ist ganz einfach – und ich weiß, das hört sich nicht gut an –, aber es ist tatsächlich das Resultat fehlender Rücksichtnahme auf die Jungen.
Einer der Wissenschaftler, die unsere Theorie teilen, ist Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther
Ebenso wie André Stein es ist seinem Vortrag Leben und Lernen mit Begeisterung anregt.